Ein Licht im Dickicht der Dunkelheit
Frauen - anonyme Heldinnen in deutsche Konzentrationslagern
18.06.2009
Aus dem Polnischen übersetzt von Waldemar Zielonka
Als ich Gefangene des Konzentrationslagers in Majdanek wurde, war ich gerade mal 13 Jahre alt, hinter mir ein gewaltiges Ausmaß an Erfahrungen aus der Bombardierung Warschaus im September 1939, das Abbrennen der Nowiniarska-Straße und unseres Hauses, drei Jahre Warschauer Ghetto, die Zeitspanne der endgültigen Liquidierung des Ghettos, der Wahnsinn der Hetzjagden in die Viehwaggons für den Abtransport in die Vernichtungslager, ein Leben für den Augenblick in der Dunkelheit der Verstecke, Keller, aufgeheizter Dachböden – Wochenlang im Bunker unter der Erde, unter brennenden Häusern während des jüdischen Aufstands im April 1943... Ich begriff, dass die aktuelle Wirklichkeit die einzige absolute Realität ist, an die sich jeder jederzeit anpassen muss, damit er existieren kann, solange die Kraft ihn nicht verlässt. Leben in dem, was im gegebenen Augenblick ist, dem Vergangenen nicht nachtrauern, nicht dem, was man jemandem herausriss und tagtäglich, stündlich tötete. Überdauern, obwohl alles dem Menschen Teure, Bekannte und Notwendige vergeht, sich unaufhaltsam bis zur Unkenntlichkeit verändert, bis der Mensch sich selbst fremd wird in einer zunehmend grässlichen, lähmenden Wirklichkeit.
Bis zum fünfzehnten Lebensjahr, bis zu meiner Befreiung aus dem letzten Lager in Deutschland am 3. Mai 1945, schaffte ich es, all das zu verinnerlichen, was den Menschen ausmacht, das menschliche Leben und insbesondere den Tod, dem ich während der ganzen Jahre auf Schritt und Tritt begegnete, wie abertausende andere Gefangene. Der Tod war ein allmächtiger makaberer Alltag.
Während dieser Zeit blieb vor allem die Mutter in allem so, wie ich sie seit jeher kannte: sich selbst treu, ausdauernd in den Grundsätzen, die sie mit Hartnäckigkeit und Beherrschung auf immer schlechter werdende Lebensbedingungen übertrug, sich blitzschnell orientierend in den sich von Tag zu Tag ändernden Situationen. Wachsam ihnen gegenüber, ohne Angst und Hysterie in einem ringsum lähmenden Grauen. Sie kämpfte für den Erhalt der Hoffnung in uns auf Überlebensmöglichkeit, die Bewahrung unseres Lebens und die Fähigkeit der Annahme eines unausweichlichen Schicksals, wenn es keine Chance gibt, dem Tod zu entrinnen. Ich bewunderte, vergötterte sie! Allein ihre Gestalt gab die Überzeugung, dass trotz des uns umgebenden Übels der Sinn des Lebens unveränderlich geblieben bist. Eine einfache, bescheidene Frau aus dem Städtchen Żelechów, Pola Kijewska, nach dem Ehemann Grynsztajn. Immer überarbeitet, still, fürsorglich. Sie half unaufhörlich dem Vater mit Häkelarbeiten beim Unterhalt der Familie sowie mit einer vorbildlichen, sehr sparsamen Führung des Haushalts. Wir waren drei Geschwister, ich und zwei ältere Brüder. Im Juli 1942 ordneten die Deutschen eine allgemeine Aussiedlung der Juden aus dem Warschauer Ghetto an, vermeintlich zum Arbeiten im Osten... Lediglich vereinzelte Häftlinge, die für sie zum Arbeiten erforderlich waren, konnten mit speziellen Bescheinigungen bleiben, mit einem so genannten „Lebensrecht“. Der ältere Bruder Marek, Medizinstudent bis zum Ausbruch des Krieges, arbeitete im noch funktionierenden Krankenhaus. Den jüngeren Bruder Chilek schleppten sie zu Arbeiten auf dem Umschlagplatz. Sie steckten ihm eine Blechnummer an, als Zeichen dafür, dass er produktiv sei und dem Abtransport nicht unterliege. Er sollte die Erschossenen, während des Antreibens in die Todeszüge zu Tode Geprügelten, hinaustragen. Die Tiefe des Entsetzens, die aus seinen Augen schrie, als er das erste Mal von dort zurückkehrte, sagte mir das, was keine Worte auszudrücken vermögen! Ich verstand das unbegreifliche Geheimnis des Überdauerns in diesem Leben für den Augenblick: in der höchsten, einzigen Liebe zum Nächsten; alles andere wurde unwichtig, kümmerlich bis zur Absurdität. Chileks Gesichtsausdruck zeigte mir die Tiefe der Verzweiflung, in der nichts mehr davon, was bisher war, was man uns lehrte und seit Generationen an uns weitergab, eine Bedeutung hatte und weit hinter uns blieb... Mein Bruder hielt den Kopf in den Händen und murmelte bloß: Fragt mich nicht, was sie mit den Menschen machen!
Ich vergaß den mich plagenden Hunger, den Wunsch nach wenigstens noch einem Löffel Klöße in einer Wasserbrühe, die Mama abends bei schwachem Kerzenlicht in irgendeiner leer stehenden Wohnung kochte; ich vergaß den zusätzlichen Zuckerwürfel herauszunehmen, den sie alle paar Stunden wie Medizin verteilte. Bis heute weiß ich nicht, woher diese kleine, zierliche Frau den Mut und die Kraft schöpfte, um damals diese Klöße in einem fremden Haus zu kochen, in einem fremden Geschirr, in toten Töpfen, die an das Schicksal der deportierten Eigentümer erinnerten und an das unsrige... vielleicht schon am nächsten Tag.
Mit Eisenstangen brachen sie Türen auf, und während sie auf die Menschen einschlugen und schossen, trieben sie sie in Kolonnen unter der Eskorte bewaffneter SS-Männer zu den Waggons. Straßen, die mit Mord schwer atmeten, Blutflecken auf Bürgersteigen und Fahrbahnen, verlassene Häuser, Geisterwohnungen. Verstreute Sachen, Briefe, Fotografien, herumfliegende Federn aus Kissen, die während der Beutezüge aufgerissenen wurden. Der Pfiff der Lokomotive drang in mein Herz wie ein Messer ein: „dorthin gingen alle, dorthin wirst du gehen, das erwartet dich, irgendeine furchtbare Station mit einem unbekannten Namen, auf der jeden Tag im Verlauf von Monaten tausende Menschen verschwinden!“.
Mama sackte auch da nicht zusammen, ihre Wachsamkeit wurde schärfer, sie plante die Möglichkeit einer Rettung, einer Flucht aus einem Versteck ins nächste Versteck.
Ich schmiegte mich an sie, drückte fest ihre Hand und hielt den Atem mit der größten Anspannung an, als aus der Nähe das Trampeln der Stiefel von SS-Männern und ein Schrei hörbar wurde, der das Blut in den Adern einfrieren ließ: „Halt, Jude! Raus!“. Mutters Ruhe, ihre Beherrschung, der Glaube an das Leben, den sie ausstrahlte, waren für mich eine Kraftquelle, das Licht und Fundament, auf dem ich blitzschnell inmitten des Grauens heranreifte. Ich entwickelte eine Feinfühligkeit, ein Verständnis und Intuition.
Es wurde dunkel, als wir vom Dachboden heruntergingen, um ein wenig nach Luft zu schnappen. Um diese Uhrzeit wurden gewöhnlich keine Straßenrazzien gemacht. Der Vater kehrte gerade aus der Fabrik und Chilek vom Umschlagplatz zurück. Gemeinsam standen wir erschöpft vor dem Haus und es schien, dass ein weiterer wie die Ewigkeit langer Tag mit der Rettung vor dem Zug zu Ende ging, als plötzlich von vier Seiten der Straße Rikschas heranfuhren. Es gab kein Zurück, vor uns bewaffnete SS-Männer: Deutsche, Ukrainer, Litauer, Letten. Ein Schrei „Halt!“. Wir sind die ersten vier, die in einer Kolonne gefangen genommen werden, die sich um die aus den Fabriken auf der arischen Seite zurückkehrenden jüdischen Männer vergrößerte, von Orten, die ein „Lebensrecht“ geben und die Möglichkeit, Brot gegen Sachen der zur Vernichtung Deportierten zu schmuggeln. Schläge, Schüsse für jede Bewegung...
Mama beruhigt uns, dass wir in den Osten zur Arbeit im Ackerbau führen, wir seien jung und gesund, nichts Schlimmes drohe uns. Ich müsse bloß überall angeben, dass ich siebzehn Jahre alt sei, denn mit dreizehn ließen sie einen nicht durch. Sie kniff mich in die Wangen, um eine Röte hervorzurufen, flocht unbemerkt eine Krone aus meinen Zöpfen, damit ich größer erschien. Sie starrte mich an und versuchte zu erraten, ob sie mir glauben würden, dass ich erwachsen und arbeitsfähig sei? Am Umschlagplatz gewaltige Menschenmenge von Gefangenen bei ganztägigen Aktionen, Schreie, Gedränge! Verzweifelte Suche nach einem Versteck, nach Wasser, nach verlorengegangenen Kindern, Verwandten, um gemeinsam mit dem Zug ins Ungewisse wegzufahren.
In einem dieser schrecklichen Augenblicke stellten die Deutschen in die Mitte des Platzes ein Maschinengewehr auf und zielten auf die Menschenmenge. Eine Stille trat ein. Die vorletzte... Fest umarmten wir uns zu viert, schauten uns gegenseitig in die Augen, so wie man sich anschaut, wenn man für immer weggeht. Chilek soll weggehen, sollten die Leichen vom Platz weggeräumt werden müssen, er bleibt aber mit uns. Vater drückt uns krampfhaft an sich. Mama erzählt mir keine Märchen mehr über die Arbeit im Osten und über meine siebzehn Jahre... Sie schaut mich ruhig an und sagt: „Jeder Mensch muss irgendwann sterben, wir werden hier und jetzt zusammen sterben, habe keine Angst, das wird nicht schrecklich sein“. Plötzlich wird alles so einfach. So stehen wir am Ende des Lebens, das irgendwann doch eintreten müsste. Ich fürchtete mich vor gar nichts mehr, alles war bereits beinahe hinter mir. Sogar der Tod erschien klein und bedeutungslos gegenüber der Macht der Gefühle in der letzten Umarmung, bei vollem Bewusstsein der eigenen Menschlichkeit.
Der Pfiff des herannahenden Zuges unterbrach die Stille der Versöhnung mit dem Tod. Das Maschinengewehr wird überflüssig. Sie werfen sich auf uns mit Gewehrkolben, Knüppeln, Stöcken, sie schießen in die voller Entsetzen umher irrende Menschenmenge. Eine Gruppe Polizisten umzingelt den Vater. Ihre Knüppel fallen auf ihn von allen Seiten hernieder. Er versucht sich mit den Händen zu schützen, dann bückt er sich, sie prügeln ihm mit Knüppeln auf den Rücken – er verschwindet samt dieser menschlichen Welle. Für immer! Mama zieht uns in die entgegengesetzte Richtung weg, Hauptsache weiter vom Zug entfernt. Chilek protestiert, weint beinahe: „Sie kennen hier jedes Versteck, sie töten euch und befehlen mir, eure Leichen wegzuräumen! Ich will diesen Augenblick nicht erleben müssen, kommt in den Zug! Das, was mit allen Juden passiert, soll auch mit uns passieren!...“ Auch ich drängte Mama zum Zug, es entsetzte mich die plötzliche Leere auf dem Platz; gleich kommen sie und erschießen uns!.. Aber Mama verschränkte in ihrer ruhigen Art die Hände auf der Brust und sagte offen: „Dumme Kinder seid ihr, dieser Zug ist der Tod! Wir müssen alles tun, um ihn zu meiden, und nicht nur dieses Mal! Niemand von den hunderttausenden Deportierten kehrte zurück, gab ein Lebenszeichen, und ein lebender Mensch gibt ein Lebenszeichen!“.
Chilek versteckte uns schnell in einem Kanalschacht, wo wir beinahe erstickten. Nicht einmal zog er hier Leichen heraus. Mama gelang es schließlich einen Polizisten zu bestechen, der uns für ihren Ehering, zwei Kilogramm Reis und einen Anzug des Vaters zurück ins Ghetto führte. Am Anfang vertrieben sie sie, warfen mit ihr wie mit einem Ball, weil sie kein Bargeld hatte. Der Preis für die Rückkehr vom Umschlagplatz betrug zehntausend Zloty pro Kopf. Danach fragte ich Mama, wofür brauchen die Leute heute Anzüge?! Sie murrte kurz, dass es keine geeignete Zeit für solche Fragen sei.
Bis zum Herbst überlebten wir in den Verstecken des Ghettos, bis eine Pause in den Razzien eintrat. Es blieben bloß Vereinzelte übrig, Familienfetzen. Es wurde klar, dass alle, die am Umschlagplatz aufgegriffen und von dort deportiert wurden, in Treblinka ums Leben gekommen waren.
Chilek heiratete sein Mädchen während einer einige Monate andauernden Pause in den Razzien. Hela blieb wie die meisten Leute, deren Familien aufgegriffen wurden, völlig allein. Ein älterer Jude erteilte ihnen den traditionellen Segen. Sie waren um die zwanzig Jahre alt... Außer Hela war noch eine Cousine mit uns, die zwei Jahre älter war als ich. Beide Brüder arbeiteten in dieser Zeit in einer Fabrik auf der arischen Seite und schmuggelten von dort Mehl und Zucker. Mama backte daraus irgendwelches Trockengebäck, Plätzchen für einen langen Aufenthalt im Bunker, denn es wurde gemunkelt, dass die Deutschen das Ghetto im Frühling liquidieren würden. Wir glaubten, dass nach der Niederlage bei Stalingrad der Krieg nicht mehr lange dauern und wir sein Ende im Bunker unter der Erde ausharren würden.
Nicht einmal sah ich, dass Mama meiner Schwägerin und Cousine etwas aus den Vorräten gibt. Ich wurde eifersüchtig, war ich doch die jüngste. Warum gibt sie auch mir nicht etwas Zucker oder ein Plätzchen?! Jedoch, obwohl ich es nicht laut sagte, las es Mama in meinem Blick ab und sagte: „Sie haben niemanden mehr und ich kann sie nicht so lieben wie dich – darum... Verstehst du?“. Ich schämte mich sehr – bis heute. In dieser Zeit allgemeiner Verwaisung inmitten einer endgültigen Vernichtung bekam ich noch eine Lehre von meiner Mutter erteilt. Einmal hörte ich, als sie zu einer Bekannten sprach und dabei auf ein Mädchen aus einer nahe gelegenen Wohnung zeigte: „Schau mal, sie ist sechzehn Jahre alt und lebt mit einem vierzigjährigen Mann zusammen, weil er Lebensmittel aus dem Kontor schmuggelt!“. Ich wusste noch nicht, was Sex ist, aber später, als ich mit einer durch den Wärter angeschossenen Hand im Krankenhaus im Männerlager von Auschwitz lag, wollte ich auf gar keinen Fall das Essen von einem sympathischen Frisör annehmen... Ich begriff, prägte mir das für immer ein.
Es wurde Ostern, April 1943, im Ghetto brach ein Aufstand der letzten jüdischen Schiffbrüchigen aus. Wir lagen auf einer Pritsche in einem überfüllten, dunklen Bunker. Über uns brannte alles, wegen Sauerstoffmangels konnte man kaum einen Streichholz anzünden. Seit fast drei Wochen bestand unsere ganze Verpflegung, die einige Male am Tag zugeteilt wurde, aus einem Stückchen Zucker und Wasser. Zu guter Letzt wurden wir von jemandem verraten. Mama zerrt an mir, um mich aus der Ohnmacht herauszureißen: „Sei jetzt nüchtern, die Deutschen gehen bereits zu uns, sie entdeckten uns!“. Entdeckten! Schon wieder der Umschlagplatz und der Zug, der schreckliche Waggon, in dem ich mich gerade noch unter dem mich erdrückenden Menschenhaufen herausriss, den toten und sterbenden Menschen, und erneut Mamas Märchen, dass wir zur Arbeit führen, Hauptsache, nicht verzweifeln... Ich weiß noch nicht, dass ich gleich weder sie noch Chilek haben werde, ich weiß es nicht und habe keine Kraft, zu wissen, was mit uns passiert, wenn der Zug endlich stehen bleibt. Ich war sicher, dass uns das berüchtigte Treblinka erwartet. Es stellte sich heraus, dass es Lublin sein sollte und das uns unbekannte Lager Majdanek. Wir küssten uns vor Freude, dass es nicht Treblinka war!...
Der Mai 1943 blies einen kalten Wind, streute Sand in die Augen. In einem gewaltigen Frauengedränge auf irgendeinem Platz bedeckte mich Mama mit ihrem Mantel, wobei sie auf in der Ferne sichtbare Baracken deutete. Sie redete mir ein, dass es bestimmt ein Lager und keine Gaskammern seien, das sei kein Treblinka. Sie werden uns nun ins Badehaus führen, geben uns andere Kleidung und wir werden in die Baracken gehen. Wir werden uns dort aufwärmen, kriegen Essen und werden arbeiten. Ich konnte es nicht mehr abwarten, fiel vor Hunger, Durst und Erschöpfung um. Unterwegs wurden die Männer von den Frauen getrennt, und bevor sie Chilek mit einer Peitsche schlugen und ihn für immer von uns wegrissen, schaffte er mich zu warnen, dass ich mich nicht auf Mama stützen solle, weil sie über mich stolpern werde. Bis zu diesem Moment stützte ich mich auf ihn, als uns SS-Männer einige Kilometer in einer Frauenkolonne trieben. Ich war barfüßig und fast nackt, denn als ich mich in dem Waggon unter dem erstickenden Haufen menschlicher Körper losriss, musste ich mich auch von meinen hohen, zugeschnürten Schuhen losreißen, wobei ich mir die Beine verletzte. Danach warf ich fast die ganze Kleidung ab, um auf dem Stoß voller Menschen und Kleidung das Fenster zu erreichen. Als ich den Kopf hinausstreckte, um etwas Luft zu schnappen, berührte mich am Hals der Gewehrlauf eines SS-Mannes, der auf einem Treppchen des Waggons stand; aber es war Nacht, er bemerkte nichts... Ich war barfüßig, auf dem fast nackten Körper hatte ich bloß einen Herrenmantel, den ich bei Dunkelheit im Waggon fand, als alle aus dem Zug herausgeworfen wurden. Draußen Regen, Schlamm. Ich konnte nicht gehen und die Deutschen schossen auf die Kranken und Schwachen. Mama nahm von einer getöteten Frau die Halbschuhe mit hohem Absatz ab, damit ich nach den rettenden siebzehn Jahren aussah, wie sie sich das vorstellte... Chilek brach einen Absatz ab, er hatte Mitleid mit mir, den zweiten schaffte er nicht mehr – gerade erreichten wir den Ort, wo sie mit Schlägen und Rumschießen die Männer von den Frauen wegrissen...
Die Deutschen holten fortwährend kleine Gruppen von Frauen heraus und führten fast alle in die Gaskammer ab, worüber wir damals keine blasse Ahnung hatten. Es dauerte Stunden. Ich betete, dass wir endlich schon an der Reihe in dieses Badehaus und das Lager sein mögen, über welches Mama sprach! Sofort!...
Sie deuteten auf uns. Eingedenk Chileks Warnung ging ich mich auf die Cousine stützend. Mama und Hela gingen hinter mir. Mama wollte mich sicherlich vor ihr im Auge behalten, wollte sehen, ob sie mich nicht als Kind zu Seite wegschieben würden. Auf dem Weg nach Lublin kreisten Gerüchte, dass Kinder, Kranke und ältere Menschen nicht ins Lager hereingelassen sondern in die Gaskammern abgeführt würden. Ich sagte Mama damals, dass sie mir in einem solchen Fall nicht folgen solle, aber sie blickte bloß ernsthaft auf mich und antwortete: „Und du glaubst, dass ich dich allein gehen lasse?!“ Der Schmerz in den Beinen machte mich nun gegen alles stumpf, ich sah nichts, hörte nichts, ich konzentrierte mich ausschließlich auf den Gedanken, wie ich den nächsten Schritt machen solle.
Und das Badehaus!
Dutzende nackte Frauen unter den Duschen, ebenso die Cousine und die Schwägerin. Mama hatte Recht – sie werden uns nicht umbringen, wir werden leben, arbeiten! Ich wollte sie umarmen, küssen wie immer, wenn es uns gelang, eine Gefahr zu umgehen... Ich suchte sie mit den Augen, ich riss die Augen nicht von der Tür. Sie wird bestimmt nach einer Weile hereinkommen, bestimmt! Ich fühlte in mir die Wärme ihres Körpers unter dem Mantel auf dem Platz, in den Ohren klangen ihre Worte über das Badehaus, das Lager, die Arbeit. Aber sie kam nicht herein, nein. Ich fürchtete, die Schwägerin zu fragen, ich fürchtete die Antwort. Mama wird gleich hereinkommen, sie muss kommen. Aber vielleicht doch niemals? - ein schrecklicher Gedanke schleicht sich ein.
„Es gibt keine Mama“, sagte mir die unverständliche Stimme meiner Schwägerin, „ich bin nun deine Mama“... Es machte mich taub. Ich blieb in einer abgrundtiefen Leere ohne Ausweg hängen, ohne Sinn. Es gibt keine Mama! Es gibt nichts mehr! Nichts! Ich ging im Kreis umher und wiederholte in völliger Abgestumpftheit: „ Es gibt keine Mama, es gibt keine Mama, es gibt keine Mama...“
Auf unsere nassen, nackten Körper schlagend und uns beschimpfend, trieben sie uns aus dem Badehaus. In einem anderen Raum schmissen sie uns Kleidung zu. Hela schleppte mich hinter sich her, zog mich an (für mich sprang ein schwarzes bodenlanges Ballkleid raus!...). Sie flehte mich an, dass ich sie nicht anschauen solle, dass sie sich meiner Blicke fürchtet. Ich starrte sie wie verrückt an, wollte in ihren Augen, in ihrer Gestalt die Mama wiederfinden, ging sie doch vor einer Weile mit ihr hinter mir her – vor einem Jahrhundert!
Hela wurde alles für mich. Sie kämpfte um einen Platz auf dem Boden in der Baracke, um eine Suppenschüssel, um winzige Essensrationen. Zuerst reichte sie sie mir, bevor sie selbst etwas nahm. Die ganze Liebe zu meinem Bruder goss sie nun in dieser Hölle auf Erden über mich und rettete mich mit ihrer Liebe, mit ihrer vollkommenen Aufopferung. Ich wollte um nichts kämpfen. Ich wollte, dass man bloß auf mir nicht herumtrampelt, und ich wollte bloß Mama, Mama! Als Hela begann schwächer und dünner zu werden, ließ ich mich zum Leben hinreißen, um sie zu retten, um mich in den Warteschlangen nach Suppe zu drängeln, um zu kämpfen. Ich wurde Helas Mutter. In der Gaskammer hielten wir uns an den Händen, nackt, wir schauten uns schweigend in die Augen. Aber es stellte sich heraus, dass in dieser Nacht das Gas ausgegangen war!
Auschwitz war eine vorübergehende Rettung... („Jede Wirklichkeit ist zu ihrer Zeit die einzig wahre – bis zu der nächsten, die auch eine solche sein wird“).
Hunger, verschwindend kleine Rationen wässriger Kohlrübensuppe, winzige Brotschnitten einmal am Tag, fortwährendes Schlagen, Beschimpfungen, Dreck, Läuse, Krankheiten aller Art, für die man ins Gas geschickt wurde. Die Unmöglichkeit, sich zu waschen und die vom Regen verschimmelte und von Exkrementen beklebte Kleidung zu wechseln. Feindseligkeiten auf den Pritschen, in den Latrinen, bei den Suppenkesseln, Arbeit über die Kräfte hinaus. Und darüber hinaus der stickige Geruch vom verbrannten Fleisch menschlicher Körper. Auf der Rampe, gegenüber unseres Blocks, Züge, Menschenmassen, die Tag und Nacht ins Gas abgeführt werden, Gepäck bis in den Himmel – eine Feuersäule und ein beißender Rauch!...
In „Kanada“ (Baracken, in denen die Sachen der Getöteten für das Versenden nach Deutschland sortiert wurden) stand ich vor Entsetzen sprachlos auf den Bergen der Kleidung, die vermischt war mit Fotografien, Briefen, Nahrungsmitteln! Ich konnte überhaupt nicht sprechen, die Worte verloren jeglichen Sinn! Es schien mir, als wenn sie alle Leute hierher getrieben und splitternackt ausgezogen hätten, und uns werden sie nach der Sortierung des Gepäcks auch in dieses Feuer werfen – und es wird keine Welt mehr geben.
Nach drei Monaten in Auschwitz verwandelte sich Hela in ein lebendes Skelett: eingefallene Wangen, große, hungernde Augen, knochige Arme, Beine. Ich mied ihren Blick, als sie mich anflehte, damit ich den Stubendienst um eine Zusatzportion Suppe bitten solle. Ich konnte den Arm nicht ausstrecken, mich mit Betteln den Schlägen und Beleidigungen aussetzen. Es war leichter für mich, meine Suppe abzugeben. Ich erklärte Hela und mir, dass falls wir von hier entkommen würden, würden wir genug Essen haben, und wenn nicht, so wird auch keine zusätzliche Ration den ewigen Lagerhunger stillen. Hela hatte keine Kraft, sich meine neunmalklugen Ratschläge anzuhören. All das wurde jedoch unwichtig gegenüber dem Klang der Trillerpfeife und den lähmenden Befehlen: „Jüdinnen zum Appell!“, „Jüdinnen, nach dem allgemeinen Appell nicht auseinandergehen!“. Man vergaß dann den Hunger, bei dem sich die Gedärme verdrehten, die Kälte, das stundenlange Knien im Schlamm bei Regen oder Frost, mit Ziegelsteinen im den gehobenen Händen, oftmals ohne Schuhe, weil sie entweder gestohlen wurden oder es wurde befohlen, sie zur Strafe für erfundene Vergehen auszuziehen. In solchen Augenblicken zählte einzig und allein das Warten auf das Urteil – der Wink mit der Hand der deutschen Herrscher: nach links, zum Tode – nach rechts, zum Leben, noch! Ich ging mit Hela auf den Platz vor dem Badehaus. Es war ein heller Herbsttag. Sie stellten uns splitternackt in einer Reihe auf. Kranke, Magere, Schwache oder einfach diejenigen, die nicht nach ihrem Geschmack waren, schoben sie nach links. Ich sah nicht schlecht aus. Ich zitterte um meine Schwägerin, sie hatte keine Chance mehr. Fortwährend rückte ich näher an Hela heran, um sie mit meinem Körper zu bedecken. Mit Mühe atmete ich vor Angst und Anspannung. Vielleicht geht er an uns vorbei, merkt nichts?! Mengele hob die Hand, ich hielt den Atem an. Hela nach links! Eine neue Wirklichkeit befreite mich schlagartig von Angst und Versklavung: ich gebe sie nicht her, ich kehre von hier nicht ohne sie zurück! Ich fasste sie mit voller Kraft und drückte sie fest an mich. Sie sind bloß Menschen, sagte ich zu mir, und nicht irgendeine höhere Gewalt, sie können das Urteil ändern, es ist alles in menschlicher Macht! Die Kapos lieferten sich mit mir ein Handgemenge, um mir Hela herauszureißen. „Wer ist sie für dich?“ - interessierte sich plötzlich ein Gehilfe Mengeles, der Unterscharführer Taube. „Das ist meine Mutter, Schwester, Schwägerin, ich kann ohne sie nicht leben“ - platzte aus mir in einem Jiddisch-Deutsch in einem Atemzug heraus. Ein SS-Mann als Herrscher über Leben und Tod urteilte logisch, dass ich mit der Schwägerin zu gehen habe, und unverzüglich trug man gehorsam meine und Helas Nummer auf die Liste derjenigen, die ins Gas bestimmt waren, ein. Nackt, mit der wie ein Skelett dürren, nackten Hela in den Armen, ließ ich mich nicht von meinem Platz beiseite drängen. Ich werde jetzt am helllichten Tag nicht sterben, sagte ich zu mir, ich werde nicht ohne sie zurückkehren! Wir kamen zusammen hierher und ich werde nicht allein von hier zurückkehren! Ich fühlte in mir die ganze Kraft meines Lebens. Der stellvertretende Lagerkommandant Hoessler, der uns gegenüber in einer Gruppe von hohen deutschen Offizieren stand, die sich die Selektion anschauten, rief mich mit einem Fingerzeig herbei. „Schweige!“ - unterbrach er mein Flehen - „wenn nicht, dann wirst du dorthin gehen“, deutete er auf das Feuer aus dem Schornstein des Krematoriums, „und wenn du still sein wirst, entlasse ich dich gemeinsam mit deiner Schwägerin“. Seine Kollegen fingen teuflisch zu lachen an, wobei sie mein ungläubiges, flehentliches „Jaaa??“ nachäfften. Und es passierte ein Wunder: Hoessler befahl unsere Nummern von der Todesliste zu streichen! Eine schallende Ohrfeige warf mich auf den Boden um, als ich mich in einer Anwandlung höchster Dankbarkeit Hoessler um den Hals warf.
Hela schleppte sich mit letzter Kraft nach mir zu den Appellen, zur Arbeit in der Nähstube. Ich bemühte mich, wie ich nur konnte, mit ihren zahlreichen Krankheiten zu kämpfen, es ihr leichter zu machen. Ich schmuggelte die Töpfchen, in die sie ihre Notdurft verrichtete, in die Latrine, da sie nicht imstande war die Tür der Baracke zu erreichen und dort dicht gedrängt in der Menge der Frauen zu stehen, die an der Ruhr erkrankten. Aus Hunderten von Kranken ließ man zehn bis fünfzehn Personen unter Bewachung in die weit entfernten Toiletten hinaus, die immer überfüllt waren! Die Verrichtung der Notdurft in das Essgeschirr wurde nahezu mit dem Tode bestraft. Ich ignorierte die Strafandrohung, dachte ausschließlich an das schnelle Leeren des Töpfchens, das Hela ständig benötigte. Es gab doch keine Möglichkeit, sich zu waschen, die Kleidung zu wechseln. Das Fieber fraß sie auf, Skorbut und der unaufhörliche Durchfall mit Blut. Sie konnte nicht mehr von der Pritsche hinuntersteigen, es wurde ihr nicht mehr der Sinn der Trillerpfeife zum Appell bewusst, und schlussendlich trug sie der Stubendienst auf einer Trage hinaus, sie legten sie im Schlamm neben mich... Sie starrte mich an, als wenn sie sich von mir verabschieden wollte, als wenn sie um Erinnerung flehte oder sich entschuldigte, dass sie mich allein lassen müsse.
Sie nahmen sie auf das Revier (Lagerkrankenhaus, d. h. Sterbehaus) mit. Nach einigen Tagen versprach mir die Blockälteste, dass sie mich zur Hela mitnehmen würde, wenn sie andere Kranke dorthin führen würde. Das Revier befand sich in einem anderen Abschnitt des Lagers. Von da an aß ich nicht mehr meine Brotrationen, ich sparte sie mir vom Mund ab, um sie Hela zu bringen, in der Hoffnung, dass sie kräftiger sein und zurückkehren würde.
Sie lag auf der oberen Pritsche wie ein Geist. Ihr Gesicht wurde heller, als sie mich erblickte. Hela riss ihren Blick nicht von mir weg, als wenn sie meine Gestalt in sich aufsaugen wollte: „Halinka, kamst du zu mir, kamst du?!“. Auf das Brot schaute sie noch nicht einmal. Sie brauchte es nicht mehr. Beinahe sofort warfen sie mich mit Schlägen von dort hinaus. Nach einigen Tagen fasste ich den Mut, beim Appell die Blockfrau nach Hela zu fragen. Sie knurrte durch die Zähne zurück, dass es sie nicht mehr gäbe. Ich fürchtete sie, aber stärker als die Angst erwies sich die Frage, ob sie sie ins Gas mitgenommen hätten oder ob sie auf der Pritsche gestorben sei. Die Blockälteste hörte für eine Weile zu fluchen und zu schlagen auf, sie schaute mich an und antwortete mit menschlicher Stimme: „Sie starb auf der Pritsche“. Also eines „natürlichen“ Todes... Sie wurde zwanzig Jahre alt.
Ich war dreizehn, sah aber nach Meinung eines SS-Mannes bei der nächsten Typhus-Selektion wie vierzig aus... Von da an eine lange Einsamkeit, Fremde, Feindseligkeiten ringsum, weil es sogar nicht genug Luft zum Atmen gab, man musste sich um alles reißen, um alles kämpfen. Schlamm, Krankheiten, eitrige Wunden am ganzen Körper, Krätze, Läuse, Typhus, Selektionen... Schlamm, aus dem man die Beine in den schweren, großen Holzschuhen nicht herausreißen konnte. Menschenfeuer aus den Schornsteinen des Krematoriums, dichter, schwarzer Rauch... Die Wirklichkeit, der man sich anpassen muss... Eine gewissermaßen neue , innerhalb einer alten, alltäglichen.
Herbst, sintflutartiger Regen. Nach einem wie Ewigkeit langen Tag, stundenlanger Schinderei bei Hunger, in Angst, mit Beschimpfungen, Schlägen, der Unmöglichkeit, seine Notdurft zu verrichten, noch kein Luxus der Eile zu den Latrinen, zu den Blocks, auf die überfüllten, verlausten Kojen; noch keine Verteilung der winzigen Brotrationen, die geistesabwesend erwartet wurden. Bloß schwindelerregende Pfiffe und ein weiterer Sturm von Flüchen, mit dem man zum nächsten Strammstehen auf dem Platz zusammen rief, Abzählen... Täglicher Abendappell. Draußen nach wie vor ein sich verstärkender Wolkenbruch. Die SS-Frauen mit Revolvern am Gürtel, in warmen, Wasser undurchlässigen Umhängen sowie die Häftlingspolizistinnen, die mit Stöcken bewaffnet darauf aufpassen, dass wir gleichmäßig zu fünft stehen, in der Entfernung eines ausgestreckten Armes. Es vergehen Stunden. Gewöhnlich herrscht um diese Uhrzeit bereits Lagerruhe und man darf sich nicht außerhalb der Blocks aufhalten. Aber nicht dann, wenn es schüttet und selbst die Natur sich mit den Folterknechten verbündet. Tausende Augen schauen flehentlich auf die unerreichbaren Barackentüren. Der Wolkenbruch nimmt immer mehr zu. Auf den Lippen die stumme, flehentliche Frage: wie lange noch? Die Frauen werden ohnmächtig, fallen in den morastigen, hier niemals austrocknenden Schlamm. Anstelle des Befehls „auseinander gehen!“ lassen sie alle auf den Knien ausharren! Man kann kaum die steif gewordenen Beine beugen. Der Regen dringt bis auf das Knochenmark durch, spült alles mitsamt dem Bewusstsein, ein Mensch zu sein, aus. Hinter dem elektrischen Stacheldraht eine Feuersäule aus dem Schornstein des Krematoriums, von Menschen, die dort massenhaft verbrannt werden, und ringsum der Geruch verbrennender Körper. Ich sah nichts mehr, fühlte nichts, als wenn ich in diesen Regen und Schlamm hineingewachsen worden wäre, ich floss mit ihnen in dem Leichenfeuer zusammen. Und plötzlich erreichen mich die Worte einer neben mir knienden Frau: „Du wirst sehen, es wird noch die Welt geben, und sie werden noch über uns Bücher schreiben, Filme über uns machen...“. Ein großartiges, unmögliches Märchen, eine himmlische Fantasie. Ein Lichtstrahl im Dickicht der Dunkelheit! Ich traf diese Frau niemals wieder, weiß nichts mehr über sie. Ob sie überlebte?
Ich drängelte mich nicht zu dem Stubendienst oder zu den Kapos, die die Lagersuppe inmitten von Schimpfwörtern und Schlägen verteilten oder um eine Pellkartoffel (ein Lagerschatz!). Niemals streckte ich flehend die Hand nach einem Nachschlag aus. Lieber wollte ich nichts essen, als dass mich die Verteilende schlagen und mir eine mit der eisernen Kelle vom Suppenkessel schmieren sollte. Eine polnische Stubenaufsicht, Stasia, bemerkte dies. Sie schaute mich streng an und goss mir eine volle Schüssel dickflüssiger Suppe ein. Aber das bedeutete viel mehr! Sie gab mir den Glauben an die Menschen zurück, den Willen zum Leben und zum weiteren Abmühen... Als ich an Typhus erkrankte, gab sie mir heißes Wasser, in dem sie ihre Nudeln, die sie von Zuhause in einem Paket erhalten hatte, auf einem Ofenbrenner im Block kochte. Niemals im Leben brauchte ich etwas dringender und nichts schmeckte besser als diese heiße Suppe!
Ein anderes Mal rettete sie mir einfach das Leben, wobei sie ihr eigenes aufs Spiel setzte. Sie ermöglichte mir die Flucht aus der Selektion, als wir völlig nackt und barfüßig vor den sortierenden SS-Männern bei klirrender Januar-Kälte draußen standen! Ich wäre damals nicht durchgekommen; ich war abgemagert, voller Geschwüre, blau vor Kälte.
Irgendwie brachte sie in Erfahrung, dass auf einen bestimmten Tag der wichtigste jüdische Feiertag Yom Kipur (Jüngster Tag) fällt. Sie verkündete damals, dass alle Dienste, das Schleppen schwerer Kessel mit einem „Quasi“-Kaffee aus der Küche (aus aufgebrühtem bitterem Grünzeug), das Aufräumen der Baracke und andere Tätigkeiten an diesem Tag Nicht-Jüdinnen ausführen würden. Als wir von der Arbeit nach einem langen Abendappell zurückkehrten, zündete sie eine Kerze auf einer der oberen Kojen an und rief: „Bleibt alle still auf den Plätzen! Und lasst uns nun für die Befreiung beten, jede in ihrer Religion!“. Stasia hatte im Block die Funktion eines Stubendienstes inne, sie war katholisch, vermutlich dreißig Jahre alt. Streng, schroff dem Anschein nach, aber ein Mensch! Soviel weiß ich bloß über sie und so behielt ich sie für immer in Erinnerung.
Es begann eine Krätze-Epidemie zu wüten. Bei den Ukrainerinnen im dreizehnten Block konnte man für eine Brotration eine schwarze Salbe bekommen, mit der sie in der Arbeit Maschinen schmierten und die angeblich Krätze heilte. Ich beschloss, obwohl nur mit Mühe, mich von meiner Brotschnitte zu trennen und diese Salbe zu erwerben. Am Eingang in die Baracke stieß ich auf Mareks Schulfreundin. Celina war Pflegerin (Krankenschwester) in dem Block. Erstaunt fragte sie mich über mein Schicksal aus und führte mich zu der Pritsche, die sie mit Prajsowa sowie mit deren Tochter Róźka teilte, die ein Jahr älter war als ich. Sie stellte mich mit den Worten vor: „Schaut mal, wie sich das Kind hier alleine durchschlägt, wie sauber sie ist!...“ Prajsowa, ein jüdischer Häftling, diente bei der Blockältesten und der Nachtwache, was ihr etwas bessere Bedingungen einbrachte. Sie war eine einfache Frau aus einer sehr armen Familie in Staszów. In den letzten Jahren lebte sie in Warschau, führte einen kleinen Lebensmittelladen im Ortsteil Praga. Während der ersten Judendeportationen aus dem Warschauer Ghetto nach Treblinka verlor sie ihre älteste Tochter, Chawcia, die besonders talentiert war, wie sie erzählte. In Majdanek entrissen sie ihr den Rest der Familie und dort schwor sie Gott alles zu tun, was in ihrer Macht stehen würde, um Menschen zu helfen, damit bloß Gott ihr gestatten würde, die jüngste Róźka zu retten. Im Verlaufe der Jahre ihrer Lageraufenthalte versuchte sie diesen Schwur zu halten. Sie drückte mir damals einige Knoblauchzehen und eine Zwiebel in die Hand, ein Geschenk einer befreundeten Polin, die Pakete von Zuhause erhielt. „Komme zu uns, wir werden dir immer bei etwas behilflich sein“, verabschiedete sie mich herzlich.
Wie auf Flügeln lief ich vom Glück beseelt zu meinem Block. Ich teilte meine Schätze, aber hauptsächlich meine Freude über die Entdeckung menschlicher Güte in dieser verständnislosen Hölle. Ich freundete mich mit Celina, Prajsowa und Róźka an. Prajsowa nannte mich von da an ihre Lagertochter und half mir getreu ihrem Schwur. Ich ging zu ihr mit jedem Problem, aber vor allem um den Ersatz für mütterliche Wärme. Wiederholt wurden mir die Schuhe gestohlen, einmal im Badehaus während einer Quasi-Desinfektion sogar die gesamten Kleider. Ich hatte nichts anzuziehen außer einem Wintermantel, und draußen war ein November-Regenwetter, Wind, Schlamm! Prajsowa gab mir einen Teil ihrer Kleidung und Róźka wies sie an, mir ihre Lederschuhe abzugeben, denn ich arbeitete im Außenkommando und sie bliebe im Block, sie bemühte sich für sie vorübergehend um Holzschuhe...
Als sie bei der Block- sowie der Nachtwache in Diensten stand, nach denen sie unter anderem die Eimer zu den weit entfernten Toiletten wegtrug und dabei im Schlamm versank, hatte sie Zugang zum Ofenbrenner. Während der Typhusepidemie stellte sie fast jeden Abend ihr blechernes Kaffeetöpfchen auf die Feuerstelle und kochte in ihm Brei aus den Hungerzuteilungen des Lagers, bestehend aus einem Stück Brot, einer Knoblauchzehe und einem Stückchen Margarine. Um das Wasser musste sie sich in die Waschräume einschleichen. Nachher verteilte sie es an Kranke, an Frauen, die vor Fieber glühend auf den Pritschen lagen, jedem ein paar Löffel. Sie versteckte kranke Häftlinge auf den untersten Pritschen und kümmerte sich um sie. Oft warnten Róźka und ich sie vor gefährlichen Folgen ihres Tuns, aber sie wollte vom Ablassen gar nichts hören. Bis sie geschnappt wurde. Als sie hörte, dass sich die Nachtwache nähert, wollte sie das Töpfchen schnell von der Feuerstelle nehmen und verbrannte sich die Hand. Sie wurde von ihr schrecklich zusammengeschlagen, und es gab keinen anderen Ausweg, als ins Lagerkrankenhaus zu gehen. Wir wünschten sie zu retten, aber womit? Mit Brot – der einzigen Medizin gegen alles im Lager, die gerade noch erhältlich war. Wir aßen unsere Brotrationen nicht auf, die einmal am Tag verteilt wurden. Wir ersetzten sie durch eine unserer Suppenrationen. Für die zweite Suppe ergatterten wir auch Brot, und auf diese Weise trugen wir jeden Abend ins Lagerkrankenhaus drei Brotrationen. Ohne eine Weile darüber nachzudenken, verteilte die erfreute Prajsowa dieses Gut an andere Kranke, strikt nach ihrem Schwur gegenüber Gott, und wir schauten dem ratlos, hungrig zu...
Es wurde schlimmer, als sich unser Besuch bei Prajsowa einmal verlängerte und die Tore beider Lagerabschnitte geschlossen wurden. Wir schafften es gerade noch auf den engen Streifen zwischen dem Lager herauszukommen, wo wir stecken blieben!... Jeden Moment konnte ein deutscher Wachmann vorbeigehen und uns für einen vermeintlichen Fluchtversuch erschießen, denn wie anders konnte er unsere Präsenz an diesem strengstens verbotenen Ort verstehen? Wir versteckten uns vor Angst zitternd unter den Sträuchern und früh am Morgen, als das Sonderkommando die Leichen vom Lagerkrankenhaus abholte, liefen wir zu unseren Blocks zum Appell herüber.
Wer wüsste heute über uns Bescheid, wenn es diese Sträucher und eine besonders dunkle Nacht nicht gegeben hätte, wenn man uns damals gefasst und umgebracht hätte?! Nach wie vielen ähnlichen Fällen blieb nicht die kleinste Spur übrig?!
Einmal vertraute sich Róźka mir aufgewühlt an, dass irgendein Mann, der im Frauenlager beschäftigt war, ihr ein Essenspäckchen geben wollte, als sie als Torwache des Blocks im Dienst war. Sie antwortete ihm, dass er sicherlich etwas als Gegenleistung von ihr erwarte, was er jedoch bei ihr nicht finden werde. Sie war damals fünfzehn Jahre alt und ich verstand kaum, worum es ging... Aber auch ich selbst erlaubte mir nicht, Essen von einem Mann anzunehmen, da ich mich an die ein bestimmtes Mädchen tadelnden Worte meiner Mutter aus dem Ghetto erinnerte.
Ania Grzęda kannte ich in Majdanek nicht (in Israel nannte sie sich Szoszana Kliger). Ich freundete mich mit ihr auf der Fahrt während meiner ersten nach vierzig Jahren stattfindenden Reise nach Polen an. Sie erzählte mir ihre Geschichte, danach half ich bei einem Interview mit ihr zu einem deutschen Buch über Majdanek. Es war eine kleine, schlanke Frau mit einem glatten, dunklen Haar, schlicht angezogen, ohne irgendwelchen Schmuck, mit großen, dunklen Augen und zusammengepressten Lippen. Sie war sechzehn Jahre alt, als die Deutschen sie in der Niska-Straße in der Nähe des Umschlagplatzes während der ersten Straßenrazzia im Warschauer Ghetto Ende Juli 1942 einfingen. Ania bückte sich, um eine geheime Zeitung aufzuheben, die ihr aus der Tasche herausfiel. Ein gerade vorbeigehender deutscher Gendarm bemerkte dies... Er brachte sie zur Gestapo auf die Szuch-Allee. Zusammengeschlagen und misshandelt steckte man sie in das Pawiak (berüchtigtes Gefängnis in Warschau, Anm. d. Übersetzers) für die „Vorübergehenden“, nach einer gewissen Zeit unter Quarantäne verlegte man sie von dort in die Jüdinnen-Zellen Nr. 15 und Nr. 8, also in die Zellen der zum Tode Verurteilten. Anias Eltern sowie ihr jüngerer Bruder wurden gefasst und in Treblinka vernichtet.
Im Januar 1943 führte man Ania in einer Gruppe Polen aus dem Pawiak hinaus und transportierte sie nach Majdanek. Sie kamen dort nachts an. Am darauf folgenden Tage wurde in der Baracke eine Registrierung durchgeführt. Nach einigen Tagen wurde sie auf die Schreibstube gerufen. Hier befand sich eine Aufseherin und der Dolmetscher Stefan, der sie fragte, ob sie Jüdin sei. Sie bejahte. Er erklärte, dass sie in eines der jüdischen Lager in der Gegend um Lublin transportiert werden müsse. Doch die Zeit verging und Ania blieb in dem „Pawiak-Block“. Sie erhielt ebenfalls eine Nummer mit einem roten Winkel, wie die polnischen Häftlinge. Stefan, ein Ukrainer, ging manchmal an ihr vorbei, als ihr Häftlingskommando zur Arbeit geführt wurde. Ihre Blicke trafen sich, aber er schwieg. Als wenn sie unter einer Decke steckten und ein gemeinsames Geheimnis hätten.
Die erste Nacht lagen sie in einer schrecklichen Enge auf dem Boden auf Heu. Wenn eine von ihnen sich drehte, mussten sich alle anderen mitdrehen. Neben Ania lag eine sehr kranke Frau mit hohem Fieber. Sie hatte Wundrose. Um es ihr leichter zu machen, stand Ania auf. Als sie lange, lange stand, kam an sie Kazia heran und fragte, warum sie so ununterbrochen stehe. Eigentlich schickte sie eine polnische Gefangene, Ewa. Ania erklärte kurz, dass sie den Platz für diese Kranke freigemacht habe... „Komm zu uns, wir rücken zusammen und machen etwas Platz für dich“ - antwortete Kazia. Von da an begann ihre Freundschaft.
Mittwoch, 3. November 1943, Tag der schrecklichen Exekution in Majdanek. Die Deutschen führten Tausende Juden aus Lublin und Umgebung heran, sie bezogen auch alle Häftlinge und jüdische Gefangene aus dem Majdanek ein und erschossen sie. Achtzehntausend Juden – Männer, Frauen und Kinder! Sie stellten Lautsprecher auf, schalteten eine lebhafte, lärmende Musik ein, schrien fortwährend, damit die jüdischen Häftlinge auf den Platz hervortraten. Die extra zu diesem Zweck ausgeschachteten Gräben füllten sich mit Leichen. Immer wieder drang in die Ohren ein: „Alle Juden heraus!“.
Ania sprang auf. Sie hielt die Anspannung nicht mehr aus. Solle es doch für immer beendet sein! Sie bewegte sich zu der Barackentür. Es herrschte eine allgemeine Sperre – man durfte die Baracken nicht verlassen, einzig und allein die Juden und Jüdinnen. Zur Erschießung!
Stefa, eine polnische Freundin aus dem Lager, stellte Ania ein Bein und zerrte sie auf die Pritsche zurück... „Verdammt, sie riefen nicht deinen Namen! Wohin?!“ Sie rettete sie. Unzählige Jüdinnen, die für Arierinnen gehalten wurden, entkamen der Exekution. Aber man gab ihnen nicht lange Ruhe. Die Deutschen begannen sie zu suchen, zu jagen, zu Ermittlungen zu beordern, woher sie nicht mehr zurückkehrten. Nun kam Ania an die Reihe. Beim Appell teilte man ihr mit, dass sie am nächsten Tag nicht zur Arbeit gehen solle. Sie sollte sich in der Politischen Abteilung zu einer Ermittlung melden. Das glich einem Todesurteil. Dunia, eine polnische Freundin von der Pritsche, betete ununterbrochen laut: „Jesus, nimm mir Ania nicht weg! Nimm Ania nicht weg!“.
In der Nacht kam eine andere Freundin, Jüdin, die im Lager für eine Polin gehalten wurde. „Was wirst du morgen machen?“ - fragte sie. Ania dachte nicht irgendetwas zu machen. „Das ist das Ende“, sagte sie. Die Frau begann sie zu beschwören, damit sie angibt, dass sie aus Zelwa stamme, eine Polin sei, die zufällig beim Schmuggeln im Warschauer Ghetto gefasst worden sei. Sie müsse es so sagen! Das Städtchen Zelwa sei bereits in sowjetischer Hand und die Deutschen könnten es nicht überprüfen, ob sie die Wahrheit sage.
Ania rang mit sich, sie wollte damit ein für allemal Schluss machen, aber, um sie los zu werden, versprach sie, dass sie gehorchen werde. Im letzten Augenblick bemerkte sie den Dolmetscher Stefan und beschloss, unverzüglich die Wahrheit zu sagen. Er weiß, dass sie Jüdin ist. Sie näherte sich der Tür des Untersuchungszimmers. Es saßen dort einige. Im selben Augenblick ging Stefan ans Telefon in ein anderes Zimmer hinaus. Sie gab die erfundene Version ihrer polnischen Herkunft aus Zelwa. Man schlug sie. Doch es passierte ein Wunder. Sie listeten sie als Arierin reinen Blutes auf. Sie kehrte aus der Politischen Abteilung als „rein arisch geprüft“ zurück! Stefa, Dunia, Marta, Ewa und andere Polinnen aus dem „Pawiacki-Block“ halfen ihr, psychisch und körperlich Majdanek zu überleben. Weitere Lager, Ravensbrück und andere überlebte sie bereits als Polin, dank der Freundschaft dieser Frauen.
Jedes der Lageropfer hatte sein eigenes Gesicht, welches das Lager durch das Leiden oder durch die hilflose Gleichgültigkeit gegenüber allem entstellte. Der Mensch ist dennoch überall er selbst, reagiert auf seine Art auf eingetretene Situationen, in denen die Verhältnisse gegenüber jeglichen Begriffen anders werden. Es verlieren sich sogar der Sinn und die Bedeutung der Wörter, wenn der Mensch gezwungen ist, seine Reaktionen unter der Last von Verfolgungen und Leiden zu ändern, unter die er fällt. Aber ebenso oft erhebt er sich über sie auf eine vorher unbekannte Hochebene seiner Menschlichkeit. Er ist fähig, übermenschliche Kräfte des Überlebens, Glaubens, des Liebens, der Aufopferungen und Entsagungen in sich zu entdecken. Ich lernte dies im Ghetto, in den Lagern kennen: Zusammengepfercht in einer Menschenmasse in den Waggons, die uns in diese Höllen fuhren, auf den Lagerpritschen, bei den Appellen. Ich prägte mir das Ringen um Lebensfetzen, um die eigene Menschlichkeit auf dem Grund der Hölle sowie das tiefe Bewusstsein über den Wert des Lebens unter jeder Bedingung ein. Die Mehrheit kam allerdings mit dem Bild eines triumphierenden Übels, einer Niederlage vor den Augen um. Man konnte damals nicht lange überlegen, am Rande des Todes, über all das aus der Vergangenheit, der Gegenwart in der Hölle... wie werden sie das in der Zukunft verstehen und beurteilen? In wechselnden Situationen musste man sich sofort neu orientieren und jeder auf seine Art reagieren.
Dank der kleinen Polusia aus Zawiercie rettete ich mich vor der äußerst schweren Arbeit im Kommando „Weberei“. Sie half mir die Norm zu erfüllen – aus Lumpen Leinen zu flechten, aber vor allem das Material zu ergattern. Dank ihrer Hilfe und der mit ihr befreundeten Kapo aus der Slowakei kam ich nach „Kanada“ (Ort, an dem die persönlichen Sachen der Ermordeten sortiert wurden, Anm. des Übersetzers), wo ich endlich einige Wochen lang in Auschwitz nicht hungern musste. Ich war jedoch direkte Zeugin eines Massenmordes und Raubes. Wir teilten mit Polusia alles wie Schwestern.
Nach meinem Entlassen aus „Kanada“ wurde ich zur Arbeit im Kartoffelkommando eingeteilt. Hier wurden Gräben für Winterkartoffeln in einer matschigen, lehmigen Erde geschaufelt, aus dem Zug wurden Kisten mit fünfzig Kilogramm Kartoffeln heruntergeschleppt, um sie in die Gräben hineinzuschütten. Ich konnte kaum auf den Beinen stehen, die Schaufel tragen... Ich erstarrte, als über mir die Kapo Alwira stand. Ein rotes, hässliches Gesicht ohne Augenbrauen und Wimpern verlieh ihr eine Strenge. Die Aufseherin schrie ununterbrochen und beschimpfte mich. Sofort fragte sie, wie alt ich sei. Ich sagte die Wahrheit, vierzehn. Soll doch das alles ein für allemal beendet sein! „Ich habe ein kleines Töchterchen zu Hause“, antwortete sie unerwartet. Wie ein Blitz ging mir neidisch durch den Kopf, dass diese böse, hässliche Frau – halb Deutsche, halb Jüdin – irgendwo noch ein Zuhause, ein Kind hat... sie warten dort auf Ihre Rückkehr, sie werden sich freuen, wenn sie zurückkommt... „Und ich habe niemanden und nichts mehr auf dieser Welt“ - antwortete ich scharf ohne Überlegung. Ich dachte, dass sie mich jetzt mit dem Spaten dafür totschlagen würde, dass ich überhaupt zu ihr zu reden wagte, einen Vergleich zu ziehen!... Alwira weinte.
Bald teilte sie mir eine gute Arbeit beim Sauerkrauteinlegen zu, wo es eine Zentralheizung und genug Kohl sowie Rüben zum Essen gab... Ich schmuggelte von dort Kartoffeln ins Lager, zur Prajsowa, die sie für uns auf einem Brenner kochte und einen Teil gegen Brot, gegen bessere Kleidung bei den Lagerinsasinnen aus dem Vorratsraum eintauschte. Ich hätte dem Heben der Kartoffeln, die in die Gräben der zerpflügten, schlammigen Erde eingesetzt wurden, nicht standhalten können! Alwira, zierlich und schlank, blieb bei ihrer Außenarbeit.
Am 18. Januar 1945 trieben sie mich verwundet nach einem Schuss in Auschwitz, mit der nach großem Blutverlust gelähmten Hand, in einer Frauenkolonne in den Todesmarsch. Kaum hielt ich mich auf den Beinen. Ich ging immer langsamer auf dem vereisten Weg, der voller Schnee war. Es vergingen Tage, Nächte ohne Ausruhen, es wurde Schnee gegessen und getrunken. Die uns eskortierenden Deutschen schossen auf Schwache, schossen für alles Mögliche. Voll Leichen mit durchgeschossenen Schläfen am Wegesrand. In einem bestimmten Moment fühlte ich, dass wenn ich mich um eine Handvoll Schnee bücken würde, würde ich nie wieder hochkommen. Es wurde mir dunkel vor Augen, als plötzlich zu mir durchdrang: „Ej, was ist mit dir?!“. Ich fiel mit dem ganzen Körper in irgendjemandes Arme. Ich öffnete die Augen – es war Alwira. Den Großteil des Weges schleppte sie mich auf ihr, selbst bereits kaum atmend. Und es war gerade sie, die mich hier rettete.
Die Menschen sind heute nicht imstande, die ungeheuerlichen Ausmaße der Verbrechen, der Qualen und der verzweifelten Hilflosigkeit gegenüber dem Übermaß an auferlegten Leiden zu begreifen. Wir, die dortigen Häftlinge, konnten uns damals auch nur mit Mühe bewusst machen, dass das, was mit und um uns passiert, womit wir jeden Tag atmen, reelle Tatsachen sind und nicht irgendein schauderhafter Traum. Darum ist vielleicht heute an diesen Orten und zu diesem Thema nicht jedes Wort das richtige und adäquat. Gegenüber diesem Thema ist alles andere leicht und schön...
Halina Birenbaum
|
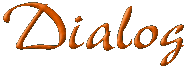
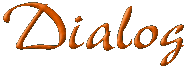
 Platform
for Jewish-Polish Dialogue
Platform
for Jewish-Polish Dialogue